Gender & Konsum
Zahlreiche Studien weisen auf Unterschiede zwischen den Geschlechtern im Konsumverhalten hin. In der Konsequenz führen diese Unterschiede im Konsumverhalten auch zu Geschlechterdifferenzen im konsumbezogenen Ressourcenverbrauch. An den Studien und ihren Ergebnissen wird jedoch kritisiert, dass Frauen und Männer häufig als homogene Gruppen betrachtet werden und dies zu einer Verallgemeinerung führt, die die Gefahr birgt, Geschlechterstereotypen im Kontext nachhaltigen Konsums zu verfestigen oder wiederzubeleben.
Eine übergreifende Problematik ist die anhaltende Dynamik der Produktion und des Konsums. Der Einfluss der Konsument*innen auf die Produktion ist eher gering und beschränkt sich auf die ‚richtige‘ Kaufentscheidung. Ein weiteres übergreifendes Merkmal des Konsums verweist mit der „Feminisierung der Umweltverantwortung“ auf die strukturelle Ebene der Geschlechterverhältnisse und die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung sowie die entsprechende Zuweisung von Care, den Versorgungs- und Sorgearbeiten.


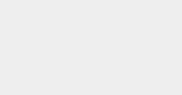
Konsum ist ein hochgradig vergeschlechtlichter Bereich, bedingt durch gesellschaftliche Rollenzuschreibungen und Identitäten, die durch Produkte vermittelt werden. Umgekehrt greifen Produkte vor allem beim Marketing Geschlechterstereotype und -klischees auf, sei es, um sie zu bedienen oder auch um sie zu thematisieren und so zu einer Veränderung beizutragen. Weltweit kursieren Daten, dass Frauen für 80 Prozent des Konsums verantwortlich sind beziehungsweise darüber entscheiden (OECD 2008). Allerdings zeigt sich ein anderes Bild, wenn der Konsum nicht an der Anzahl der gekauften Produkte gemessen wird, sondern an der Höhe des dafür ausgegebenen Geldes. So betrachtet sind Männer für ebenfalls 80 Prozent der Konsumausgaben verantwortlich (siehe UBA Abschlussbericht, S.118f).
Die wesentlichen Genderdimensionen
Der Bereich Konsum weist enge Verbindungen mit der Genderdimension Versorgungsarbeit auf. Die Entscheidung über Ressourcenschonung und deren mögliche Folgen für die in Privathaushalten agierenden Personen wird bei Gütern des täglichen Bedarfs aber auch im Bereich der sozialen Innovationen und (Produkt-)Dienstleistungssysteme auf diejenigen verlagert, die Versorgungsarbeit leisten. Neue, wenn auch sinnvolle Alltagspraktiken, Lebens- und Konsumformen führen möglicherweise zu einer Mehrbelastung für diejenigen, die ihre Alltagsroutinen ändern und die Praktiken umsetzen müssen. Hier werden tendenziell eher die traditionell für die Versorgungsarbeit verantwortlichen Frauen belastet. Es gibt erste Hinweise darauf, dass egalitärere Familienrollen nachhaltigen Konsum unterstützen können, dass aber gleichzeitig Aushandlungsprozesse in bestimmten Lebensphasen, wie z. B. nach der Geburt eines Kindes, eine traditionelle geschlechtsspezifische Aufgabenverteilung verstärken können, bei der die Verantwortung für nachhaltigen Konsum den Frauen zugewiesen wird. Andererseits gibt es Hinweise darauf, dass biografische Übergänge und Lebensereignisse bedeutende Chancen bieten können, die die Wahrnehmung und Akzeptanz nachhaltigerer Konsumformen unterstützen können.
Noch ist unklar, wie sich geschlechtsspezifische Ungleichheiten in der Verteilung von Zeitbudgets für bezahlte und unbezahlte Arbeit auf nachhaltigen Konsum auswirken bzw. auf welche Weise nachhaltiger Konsum entweder Zeit spart oder kostet.
In Bezug auf die Genderdimension Erwerbsarbeit ist zunächst zu beachten, dass unentwirrbare Verbindungen und wechselseitige Beziehungen innerhalb eines Gesamtsystems von Konsum und Produktion bestehen. Im Jahr 2019 waren in Deutschland 65,1 % aller Bürokräfte und kaufmännischen Angestellten Frauen. Bei Erwerbstätigen in Dienstleistungsberufen wie etwa Verkäuferinnen waren Frauen mit einem Anteil von 61,7 % vertreten. Unterrepräsentiert waren Frauen im Handwerk sowie in Industrie und Landwirtschaft. Nur 11,7 % der Erwerbstätigen in Handwerksberufen waren weiblich. Arbeiten in der Industrie (zum Beispiel Bedienen von Maschinen und Anlagen sowie Montagearbeiten) wurden zu 13,7 % von Frauen erledigt. (Statistisches Bundesamt) Weltweit betrachtet ist jedoch beispielsweise die Textilindustrie eine der am stärksten von Frauen dominierten Branchen der Welt. Im Hinblick auf nachhaltigen Konsum müssen Fragen der sozialen Gerechtigkeit berücksichtigt werden, insbesondere die Arbeitsbedingungen, unter denen die Produkte hergestellt werden.
Analysen zeigen auch, dass bei steigendem Einkommen mehr Ressourcen verbraucht werden und dass bei sinkendem Einkommen weniger Ressourcen verbraucht werden. Umgekehrt geht ein höheres Einkommen auch mit der Bereitschaft einher, nachhaltigere Alternativprodukte zu kaufen. Die zentrale Bedeutung der Einkommenshöhe für den nachhaltigen Konsum wirft die bisher unbeantwortete Frage auf, welchen Einfluss im Durchschnitt die höheren Einkommen von Männern und die niedrigeren Einkommen von Frauen auf den nachhaltigen Konsum haben.
Im Bereich der Sharing Economy ist zu vermuten, dass Start-ups aufgrund ihres Schwerpunktes auf digitalen Medien und damit auf Informatik eher männerdominiert sind und dadurch möglicherweise auch deren Vorlieben und präferierte Arbeitsformen widerspiegeln.
In Bezug auf öffentliche Ressourcen ist u.a. bei gemeinschaftlicher Nutzung eine gerechte Verteilung des Zugangs zu öffentlichen Räumen zu beachten. Einige Studien deuten darauf hin, dass dies bisher nicht unbedingt der Fall ist. Zu beachten sind hierbei u.a. die Partizipation an städtischen Sharing Initiativen und die Zugänglichkeit und Nutzung von in der Regel Online-Sharing-Plattformen für verschiedene soziale Gruppen einschließlich aller Geschlechter.
Der Gender-Gap bei der Definitions- und Entscheidungsmacht zeigt sich auch im eher geringen Anteil von Frauen bei der Produktentwicklung und kann sich in einer Produktgestaltung niederschlagen, die an den Bedürfnissen und Bedarfen der Konsumentinnen vorbeigeht. Ebenso ist die Frage, ob neue Produkte überhaupt gewünscht und erforderlich sind, unter Beteiligung der Verbraucherinnen und/oder ihrer Vertretung in Form von Frauenverbänden als auch Einbeziehung der Genderexpertise aus dem Bereich Produktentwicklung/-design zu klären.
Analyseebenen
Geschlechterbezüge von Konsum lassen sich – neben der gängigen Unterscheidung von Sex als biologisches Geschlecht und Gender als die soziale Konstruktion von Geschlecht – noch weiter ausdifferenzieren. Dabei lassen sich drei Ebenen der Analyse unterscheiden:
Individuelle Ebene: Im Fokus stehen mögliche Geschlechterdifferenzen in den konsum- und nachhaltigkeitsbezogenen Einstellungen, im Konsumverhalten und dem damit verbundenen Ressourcenverbrauch.
Strukturelle Ebene: Der Hauptfokus richtet sich auf die Analyse der geschlechtsspezifischen Arbeits- und Machtteilung und ihre Bedeutung für (nachhaltigen) Konsum. Damit wird die Aufmerksamkeit auf die Verteilung der Be- und Entlastungen gerade auch im Bereich Care, die mit diesbezüglichen Verhaltensänderungen einhergehen, gelenkt.
Symbolische Ebene: Hier geht es u.a. um die Frage der Bewertung und gesellschaftlichen Wahrnehmung von Produktion und Konsum, sowie die den Analysen und Debatten über (nachhaltigen) Konsum eingeschriebenen Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit eine Rolle.
Nachhaltiger Konsum unter Genderperspektive
Nachhaltiger Konsum als gesellschaftliches Ziel ist dringend notwendig, um die großen sozialen und ökologischen Probleme unserer Zeit zu lösen. Die Marketingforschung dokumentiert vielfach das geschlechtsspezifisch unterschiedliche Konsumverhalten von Frauen und Männern – hier beklagen die Nachhaltigkeitswissenschaften eine Forschungslücke. Zentrale Fragen, die jetzt in einem dreijährigen Forschungsprojekt adressiert wurden, sind zum Beispiel:
- Gibt es geschlechterdifferente Nachhaltigkeitskompetenzen?
- Wählen Frauen und Männer unterschiedliche Strategien zur Entwicklung einer sozial und ökologisch ausgerichteten Konsumhaltung?
- Bestehen geschlechtsspezifisch unterschiedliche Vorbehalte gegen nachhaltigen Konsum? Wie können die Geschlechter zur Veränderung ihres Konsumverhaltens angeregt werden?
- Welche gendersensiblen Kommunikationsstrategien versprechen Erfolg?
Weibliche Konsumlust und männliche Qualitätssucht
Wie stark sich männliche und weibliche Interessen in puncto Konsumverhalten wirklich unterscheiden hat eine Studie des GFK Vereins untersucht. Auffällig ist daran vor allem, dass die Gesellschaft in vielen Fragen eine sehr einheitliche Meinung vertritt.
Qualität ist ein kaufentscheidendes Merkmal, das sowohl 48 Prozent der Frauen als auch 49 Prozent der Männer hoch einschätzen. Auch in Sachen Mode-Individualität liegen männliche und weibliche Ansichten nahe beieinander. In der grundsätzlichen Haltung gegenüber Konsum und Einkaufen in den Innenstädten fallen jedoch Unterschiede auf: Während jede zweite Frau kauft, was ihr gefällt, stimmen diesem Motto nur 39 Prozent der Männer zu.
Frauen sind zu 73 Prozent davon überzeugt, dass Einkaufen Spaß macht, Männer nur zu 40 Prozent. 78 Prozent der Frauen bevorzugen ein designtechnisch anspruchsvolles Wohnumfeld wohingegen nur 42 Prozent der Männer diesen Aspekt als wichtig erachtet. Dreiviertel aller Frauen unter 30 empfinden ein modisches Äußeres als wichtig und beinahe 70 Prozent der Männer geben sich in dieser Altersgruppe ebenfalls gerne trendbewusst. Zum Thema Auto finden 56 Prozent der Männer, dass ein Auto auch gut aussehen und nicht nur funktionieren muss, dem stimmen 43 Prozent der Frauen zu.
Das Alter der befragten Teilnehmenden stellt sich bei den Antworten als so gut wie irrelevant dar. Selbst wenn sich Einstellungen im Laufe des Lebens wandeln, bleibt der durchschnittliche Unterschied zwischen den Geschlechtern weitestgehend konstant.
Ausgewählte Publikationen
- Abschlussbericht Vorlaufforschung: Interdependente Genderaspekteder Bedürfnisfelder Mobilität, Konsum, Ernährung und Wohnen als Grundlage des urbanen Umweltschutzes. Gender Mainstreaming für eine zielgruppenspezifischere, effektivere urbane Umweltforschung (2020)
Der vom Umweltbundesamt herausgegebene Abschlussbericht stellt den aktuellen Forschungsstand zur Bedeutung von Geschlecht und Geschlechterverhältnissen für eine umweltschonende Gestaltung der Bedürfnisfelder Wohnen, Mobilität, Bekleidung und Ernährung sowie zu den Querschnittsthemen gemeinschaftlicher Konsum und Digitalisierung dar. Er formuliert neue Forschungsfragen und -felder für den urbanen Umweltschutz auf Basis der vorgefundenen rollenspezifischen Zuständigkeiten und Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern, wie zum Beispiel die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und Einkommen oder geschlechtsspezifische Konsum- und Ernährungspraktiken. - Green Economy und Konsum: Gender_gerecht (2012)
In diesem Hintergrundpapier erörtert Ines Weller die Rolle privater KonsumentInnen in einer Green Economy. Sie weist dabei auf die Problematik der Feminisierung und Privatisierung von Umweltverantwortung hin. Eine grundlegende Voraussetzung für aktives und gestaltendes Konsumverhalten in einer Green Economy ist Transparenz und Information über Produktionswege und -mittel. Aber nicht nur das Kaufverhalten muss beachtet werden, auch das Nutzungsverhalten von Gütern kann sich in neuen Formen der gemeinschaftlichen Nutzung oder in Do-it-Yourself-Projekten verändern. - Moving beyond gender differences in research on sustainable consumption. Evidence from a discrete choice experiment (2010)
Der Beitrag von Julia C. Nentwich, Ursula Offenberger, Stefanie Heinzle und Josef Känzig führt eine neue Art der Konzeptualisierung und Erforschung von Geschlecht und Konsumverhalten ein, indem er die Ergebnisse von Discrete-Choice-Experimenten mit Schweizer Konsumenten untersucht. Die Autoren analysierten stated preference-Daten zu Entscheidungen über den Kauf von Waschmaschinen und rezensierten Literatur aus der Geschlechter- und Technikforschung. Insgesamt zeigen die Ergebnisse die Relevanz von Geschlechterbeziehungen und Geschlechterskripten für die Analyse von Geschlechtereffekten im Konsumverhalten. Ihre Ergebnisse tragen zu einem Verständnis von Geschlecht im nachhaltigen Energiekonsum bei und weisen den Weg, über die Analyse von Geschlecht als individuelle Unterschiede hinauszugehen. - Gender aspects of sustainable consumption strategies and instruments (2009)
In diesem Papier stellen Irmgard Schultz und Immanuel Stieß Argumente und Beispiele für die Integration von Gender-Aspekten in Strategien und Instrumente des nachhaltigen Konsums vor. Das Papier fasst einige zentrale Punkte der theoretischen und konzeptionellen Debatte zu 'Gender und nachhaltigem Konsum' zusammen und gibt Hintergrundinformationen zu Gender-Politiken im internationalen, UN- und EU-Kontext, einschließlich der wichtigsten Diskussionspunkte.
Wir verweisen an dieser Stelle noch einmal auf unser Projektarchiv und da vor allem auf das Projekt Interdependente Genderaspekte der Bedürfnisfelder Mobilität, Konsum, Ernährung und Wohnen als Grundlage des urbanen Umweltschutzes.
